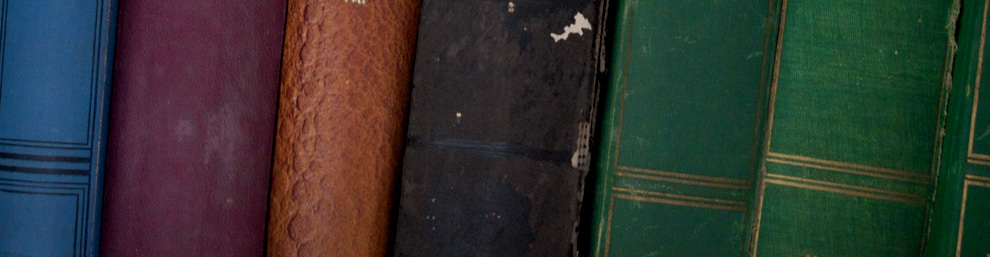Seit meiner (erzwungenen) Auszeit vor gut dreieinhalb Jahren denke ich mal mehr, mal weniger an Veränderungen herum. Was und wie will ich eigentlich arbeiten? Ist das, was ich tue, passend für mich? Bin ich auf dem richtigen Weg, „lohnt“ sich der ganze Stress?
Ich habe immer noch keine Antworten, aber ich nähere mich einer Entscheidung und freue mich sehr darüber, dass sich in den letzten Tagen viel bewegt hat.
Ich habe jede Menge Ideen im Kopf und auch wenn manches noch ein bisserl im Nebel liegt, wird doch einiges allmählich klarer. Das trägt mich durch die sehr stressige Zeit, die ich im Moment in meinem Hauptjob habe und die mir so überhaupt nicht gefällt. Aber ich bin niemand, die Hals über Kopf alles hinwirft, wobei mir etwas mehr Gelassenheit und Mut sicher gut tun würde.
Jedenfalls werde ich hoffentlich in den nächsten Monaten berichten können, was gerade so passiert, und werde bis dahin weiterhin versuchen, die einzelnen Fäden zu entwirren und sinnvoll zusammenzufügen.
Letzten Sonntag hatte ich ein kleines Konzert, was sich im Nachhinein zumindest für mich als etwas größer entpuppte. Ich singe ja seit fast vier Jahren in einem „klassischen“ dörflichen Gesangverein. Dort gibt es mehrere Chöre, und der gemischte Chor ist von der Zusammensetzung der Sänger her der älteste. Ich schätze das Durchschnittsalter dort locker auf 70, wenn nicht gar 73 Jahre. Dieser Chor tritt nur noch selten auf, aber damit niemand gänzlich „einrostet“, gibt es ab und zu doch mal ein Konzert. Obwohl der Chor zu 90% aus Katholiken besteht, hatten sie sich bereit erklärt, in der evangelischen Kirche ein kleines Konzert mit Lutherliedern zu geben. So weit, so gut.
Ich hatte die Noten einer sehr selten gespielten, aber wunderschönen spätromantischen Motette über einen Luthertext für Sopransolo, Chor und Orgel zuhause und unser Chorleiter meinte, das könnte der Chor schaffen. Ich sollte die Orgelstimme spielen und eine Sopranistin aus einem befreundeten Chor würde das Solo probieren.
Es stellte sich dann heraus, dass der Chor wohl insgesamt nicht genügend Lieder für ein komplettes Konzert zusammen bekäme und so wurde ich gefragt, ob ich denn sonst noch etwas beitragen könne.
Und wie das dann so ist, hatte ich im Konzert alle Hände voll zu tun. Ich spielte neben der Motette noch vier Orgelstücke solo, sang drei Lieder allein und begleitete den Chor bei drei weiteren Chorälen. Da ich am Morgen auch noch zwei reguläre Gottesdienste in zwei unterschiedlichen Kirchen georgelt hatte, war ich am Abend doch ziemlich müde und hätte im Anschluss direkt ein weiteres Wochenende gebraucht 🙂
Aber es war sehr schön und für meine weitere Konzertplanung auch durchaus lehrreich.
Ab sofort kann man übrigens mit „meinem“ Chor (etwas jünger 😉 ) fürs Weihnachtsoratorium (Teile I, IV, V, VI) mitproben, immer dienstags ab 20:45h, Nähe Butzbach/Gambacher Kreuz. Bei Interesse einfach bei mir melden!